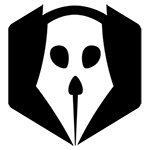„An Amor!
Erlogen ist das Flügelpaar,
Die Pfeile, die sind Krallen,
Die Hörnerchen verbirgt der Kranz,
Er ist ohn‘ allen Zweifel,
Wie alle Götter Griechenlands,
Auch ein verkappter Teufel.“
- Goethe, Faust
Warum können wir Schmerz genießen? Warum ist es einfacher traurig zu sein, als glücklich zu sein? Wieso können wir uns das so leicht einreden? Warum suhlt man sich im Selbstmitleid und fühlt sich stark dabei? Wieso können wir uns selbst bewusst manipulieren? Wieso können wir uns selbst zerstören? Lieben wir uns selbst so wenig?
„[…] das asketische Ideal entspringt dem Schutz- und Heil-Instinkte eines degenerierten Lebens“ (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 366). Was hat es mit dem Schmerz auf sich? Warum tun wir uns selbst Schmerz an? „Wir sind schließlich Menschen, wir entwickeln früh Schuldgefühle, haben Angst, wenn das Glück machbar wird, und haben den Drang, die anderen zu bestrafen, weil wir uns ständig ohnmächtig, ungerecht behandelt und unglücklich fühlen. Für seine Sünden bezahlen und die Sünder bestrafen können – ist das nicht köstlich?“ (Paul Coelho, Elf Minuten, S. 208). Auch ich habe mich schon oft im Selbstmitleid gesuhlt und bewusst in diesen Zustand gebracht und irgendwann, als der Schmerz überwunden war, habe ich mich tatsächlich danach zurückgesehnt (nicht nur aus Genuss, sondern vor allem aus künstlerischen Gründen, da Kummer meine Kreativität anregt), als ich mir dann den Blödsinn aus dem Kopf geschlagen habe, habe ich mich gefragt, wieso wollte ich diese Gefühle, diesen Schmerz, genauso wie beim ersten Mal, wieder durchleben. Einige Male durchlebte ich diesen Kreislauf des Sich-nach-Schmerz-sehen-und-dann-fragen-wieso. Bis ich mir dann schließlich komplett albern vorgekommen bin. Wieso könnte jemand freiwillig so etwas tun? Ist das menschlich oder sind alle Schmerzfanatiker krank?
Zu diesem Thema, was schon lange, leise in meinem Kopf rumschwirrt, bin ich gekommen, als ich etwas über Kafka las. Kafka inspiriert mich eigentlich fast immer. Und wenn ich Kafka lese, stelle ich ihn mir immer als Autor vor, wie er nachts, es muss nachts sein, an seinem Schreibtisch sitzt und schreibt; und dann denke ich immer auch an mich, Emilia, die Autorin und sehe mich ebenso nachts am Schreibtisch sitzend und schreibend. Kafka berührt mich, wie es kein anderer Autor kann.
Ich las eine Beschreibung über Kafka von Franz Blei 1922 im ‚Bestarium der modernen Literatur‘ veröffentlicht: „‚Die Kafka‘ nun sei ‚eine sehr selten gesehene prachtvolle mondblaue Maus, die kein Fleisch frißt, sondern sich von bitteren Kräutern nährt. Ihr Anblick fasziniert, denn sie hat Menschenaugen.‘“ (Haimo Stiemer, Das Habitat der monblauen Maus, S. 127) und eine dazugehörige Kritik von Gregor Eisenhauer: „Die Erbärmlichkeit einer Kreatur, die, gefangen in einem falschen Körper, auf ihre Auslieferung an ein erbarmungsloses Schicksal wartet und im Glauben an ihre Mitschuld selbst dafür kasteit – nicht ohne Vergnügen.“ (Ebd.). Kafka ‚kasteit‘ (bestraft) sich selbst und weiter heißt es ‚nicht ohne Vergnügen‘ – es macht ihm auch noch Spaß! und da kam es über mich, und ich erinnerte mich an all die Texte, die ich las in denen der Schmerz als etwas genussvolles beschrieben wurde. Alleine schon ‚Venus im Pelz‘ von Leopold von Sacher-Masoch. In dem Text geht es um einen Mann, der von einer Frau Gewalt angetan bekommen will, weil ihn das glücklich macht. „Lieben, geliebt werden, welch ein Glück! und doch wie verblaßt der Glanz desselben gegen die qualvolle Seligkeit, ein Weib anzubeten […], die uns unbarmherzig mit Füßen tritt.“ (Leopold von Sacher-Masoch, Venus im Pelz, S. 14). Warum finden es Menschen sexuell erregend, wenn sie Schmerz empfinden? „‚Sie sehen die Liebe und vor allem das Weib‘, begangen sie, ‚als etwas Feindseliges an, etwas, wogegen Sie sich, wenn auch vergebens, wehren, dessen Gewalt Sie aber als eine süße Qual, eine prickelnde Grausamkeit fühlen; eine echt moderne Anschauung!‘“ (Ebd. S. 17). „Als ich die Demütigung und die totale Unterwerfung erfahren habe, war ich frei.“ (Paul Coelho, Elf Minuten, S. 204). In dem Buch ‚Elf Minuten‘ von Paul Coelho geht es um eine Frau, Maria, die aus Brasilien in die Schweiz kommt und dort Prostituierte wird. Ein Freier, den sie einige Male trifft, führt sie in die Welt des Sadomasochismus, „Ich sage es noch einmal: Es liegt in der Natur des Menschen. Seit wir aus dem Paradies vertrieben worden sind, erfahren wir Leid oder sehen zu wie andere leiden. Das lässt sich nunmal nicht ändern.“ (Ebd. S.190), und es gefällt ihr, es gefällt ihr Schmerzen zu erleiden, so gut, dass sie einen Orgasmus bekommt. Doch ihr Freund, nachdem sie es ihm erzählt hat, will sie davon wegbringen und redet ihr das Gefallen am Schmerz aus. Hat er recht? Nietzsche, unser liebster, meist missverstandener Nihilist meint über den asketischen Priester in seiner Genealogie der Moral: „[…] hier wird ein Versuch gemacht, die Kraft zu gebrauchen […] hier richtet sich der Blick grün und hämisch gegen das physiologische Gedeihen selbst […], die Schönheit, die Freude; während am Missraten, Verkümmern, am Schmerz, am Unfall, am Hässlichen, an der willkürlichen Einbusse, an der Entselbstung, Selbstgeisselung, Selbstopferung ein Wohlgefallen empfunden und gesucht wird.“ (Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, S. 363). Und hat er Recht? Ist Schmerz ein Teil von uns, wie Freude, Liebe, Ekel, Furcht, Unzufriedenheit? – das ist so zu fragen, ob Bono Teil der Band U2 ist. Aber warum gefällt es uns? Warum können wir uns danach sogar sehnen? Wie Elif mit ihrem neuen Album (was erst im September diesen Jahres rauskommt) ‚ENDLICH TUT ES WIEDER WEH‘. – Endlich ist der Schmerz wieder da und Elif kann darüber singen. Bringt der Schmerz uns irgendwie weiter? Kann der Schmerz etwas für uns tun, außer schmerzhaft zu sein? Ist am Ende doch nicht alles so schwarz-weiß und Schmerz ist nicht negativ sowie von uns (zum Schutz?) festgelegt? Lassen wir uns Chancen entgehen, wenn wir den Schmerz nicht zulassen? Oder sind wir dumm, wenn wir darin eine Lust empfinden können?
Ist es am Ende ambivalent?
Keine zufriedenstellende Antwort, wenn es überhaupt eine ist. Aber hier halte ich mich wie Kafka, der seine Figuren auch Fragen stellen ließ, große Fragen über das Leben, und diese auch nie eine Antwort bekommen haben (vgl. Yvonne Al-Taie, Poetik der Unverständlichkeit, S. 295).