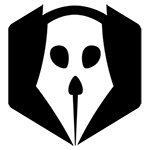Einsamkeit ist der wahre Schmerz. Und wahre Einsamkeit ist, wenn du dich am einsamsten fühlst, immer dann, wenn du gar nicht allein bist.
Wir gingen die zugefrorene Treppe hinab, ganz vorsichtig, wir hatten Angst zu stürzen, so reichten wir uns netterweise die Hände. Wir waren zu sechst. Kamen gerade aus dem Kino. Schon etwas angetüdelt vom Sekt, vor dem Film bei mir zu Hause. Aber anders ertrugen wir Johnny Depp als Pirat nicht. Marlene rutschte aus und fiel fast hin, doch Freddy rettete sie ritterlich. Es brach ein lautes Gelächter aus – nicht wegen dem Ausrutschen, sondern der urpeinlichen Rettungsaktion, in der sich Freddy profilieren wollte. Alle wussten, dass er Marlene toll fand, deswegen war es noch komischer. Marlene verstand nichts und bedankte sich nur. Sie verstand oft nichts, aber wir kannten alle niemanden der herzlicher war als sie. Tobi machte noch eine Weile über den hoffnungslos Verknallten Witze, weil Tobi oft nicht verstand wann Schluss war oder wenn etwas nicht mehr witzig war. Elisabeth sagte, er soll sein Maul halten. Ihr Freund Paul, der neben ihr hertrottete, sagte wie immer nichts. Er war immer ruhig, doch wenn du ihn mal was fragtest, erzählte er die besten Geschichten. Nach langem Überlegen im Fahrstuhl in welche Etage wir mussten, kamen wir doch noch bei unserem Autos im Parkhaus an. Tobi und Freddy fuhren bei Elisabeth und Paul mit und Marlene nahm mich mit. Sie ließ mich in meiner Straße raus. Die letzten Meter lief ich allein. Allein durch den Schnee. Nur das Knirschen des flauschig gefrorenen Wassers konnte man unter meinen schwarzen Schnürstiefeln hören. Ich war die erste, die sich im frisch gefallenen Weiß verewigen konnte. Alle paar Schritte drehte ich mich um, um meine Fußspuren anzuschauen. Schön. Zufrieden ging ich im orangefarbigen Straßenlaternenlicht die letzten Stufen zu meiner Haustür hoch. Entspannt kramte ich den Schlüssel zu meiner Wohnung aus der Jackentasche und schlüpfte hinein. Schlüpfte in meine weiß gestrichene Wohnung. Ich schaltete das Licht an und sah mein Gesicht mit rosa Wangen unter einer tiefsitzenden schwarzen Mütze. Ich erschrak, als ich mein Lächeln sah. Es verschwand sofort. Ich lag im Bett und dachte über den heutigen Abend nach. Wir waren alle zuerst hier. Ich muss noch aufräumen. Wir hatten eine lustige Zeit. Wir schauten den Film. Ich saß zwischen Elisabeth und Tobi. Marlene fuhr mich netterweise nach Hause. Ich habe sogar gelächelt. So kann es doch weitergehen. Alles wird gut.
In zwei Wochen ist Valentinstag. Alles ging seinen gewohnten Gang. Alle gingen ihrer Arbeit nach und ich meinem Studium. Die anderen waren mit ihrem Studium schon fertig, bei mir dauerte es etwas länger, weil ich zwischenzeitlich einen Fachwechsel hatte. Ich pendelte jeden Tag zur Uni. Eine Stunde saß ich jeden Morgen und jeden Abend im Zug. Meistens länger. Wir wohnten alle in der gleichen mittelgroßen Stadt. Nach Köln zu ziehen, wo meine Uni war, traute ich mich nicht, weil ich Angst hatte mein Umfeld zu verlassen und mich noch mehr verloren zu fühlen. Meine Freunde interessierte das eher weniger. Manche machten ein Fernstudium. Freddy machte eine Ausbildung und der Rest pendelte mit dem Auto zu einer Uni nicht zu weit weg. Ich hatte meine Kopfhörer drin. Noch drei Haltestellen, dann musste ich in die kalte, gnadenlose, stinkende und laute Luft Kölns. Vom Südbahnhof waren es zum Glück nur fünf Minuten bis zu meiner Fakultät. Heute war der letzte Tag mit Präsenzveranstaltungen vor dem Semesterferien bzw. vor der Klausurenphase bzw. vor meinem kreativen Loch, in dem ich vollkommen leer werde, gleichzeitig Kraft verliere und Kraft tanke, weil nichts zu tun für einen Monat sehr anstrengend ist, weil du den Bezug zum Alltag verlierst, wenn du in deinen Gedanken gefangen bist und gleichzeitig ist es befreiend, weil du mit niemanden reden musst und zu neuen Erkenntnissen kommen kannst. Heute war eine reine Fragerunde bezüglich der Klausur in dem einen Seminar und in der Vorlesung wurde das Semester mit dem Abschlussthema und einer Diskussionsrunde beendet. Normalerweise würde ich mich jetzt in die Mensa schleppen lassen, aber Anja war heute nicht da. Soll ich schon nach Hause fahren? Aber was mach ich dann den ganzen Tag? Nein, ich fahre eine Stunde später. Ich ging nicht zum Südbahnhof, sondern fuhr mit der Neun zum Neumarkt und schlenderte durch die Schildergasse.
Ich war abwesend, ein Beobachter meiner selbst. Die Menschenmassen gehörten zur Kulisse. Sie bewegten sich kaum. Ich schlenderte, drehte meinen Kopf nicht bewusst nach links und rechts, sondern ließ den Blick einfach durch alles hindurchsehen. Ich ging in keinen Laden rein, immer daran vorbei. Es war so still, bis ich ein Gesprächsfetzen hörte und dann wurde es immer lauter, bis es unaushaltbar wurde und ich bereute hier her gekommen zu sein. Ich bat Passanten nur mit meinen Augen um Hilfe. Keiner schaute mich an. Ich suchte hektisch nach einem ruhigen Ort. Doch nirgends war es ruhig. Ich setze mich unter einem Baum, auf eine Bank, die auf der Domplatte stand und steckte mir beleidigt Kopfhörer in die Ohren – beleidigt vom Lärm. Ich würde ruhiger. Ich hätte sofort fahren sollen. Was habe ich mir gedacht? Ich blickte auf die große Uhr hinter mir, die auf der Frontseite des Hauptbahnhofs. Noch dreißig Minuten bis mein Zug kommt. Ich war wieder am Tagträumen, von besseren Tagen. Das ist das einzige was die Zeit vergehen lässt. So mühelos versetzte ich mich in irgendwelche ausgedachten Szenarien, die nie passiert sind und die passieren werden, aber die schön sind. Szenarien, in denen ich die Hauptfigur bin. Die Zeit ist um. Erschöpft von den Menschen um mich, bewege ich mich zu meinem Gleis, noch halb am Träumen, nicht anwesend. Nie anwesend. Ich bin nie anwesend. Ich bin nie in der Gegenwart, im Hier. Ich bin entweder am Träumen oder außenstehender Beobachter der Situation, in der ich mich befinde, aber nie Teilnehmer. Nie teilnehmen möchte und nie gefragt werde, ob ich teilnehmen möchte. So schaue ich mir alles interessiert an und zerlege jede vergangene Sekunde in ihre Einzelteile, sobald ich zu Hause bin, weil ich nichts anderes zu tun habe und keine Kraft, um etwas anderes zu tun zu haben. Ich erlebe Dinge, aber nie wirklich, nie ohne ein stechendes Gefühl weit im Hinterkopf, welches mir alle Leichtigkeit nimmt und das Genießen unmöglich macht. Auch wenn ich lache und mich freue und herumalbere, ist das für mich kräftezehrend, weil es nie unbeschwert ist, immerzu denke ich an etwas. An irgendwas Unnötiges.
Der Zug kommt. Die Tür geht auf. Ich steige ein. Ich gucke aus dem Fenster. Ich gucke immer aus dem Fenster. Ich gucke mein ganzes Leben lang aus dem Fenster. Mein Leben ist ein Aus-dem-Fenster-gucken. Ich bin gleichzeitig hinter dem Fenster und davor. Alles fährt an mir vorbei, ohne mein dazutun, langsam und gleichzeitig schnell. Mein Handy vibriert. Ich zucke.
„Du wirst es nicht glauben, aber…“, Marlene fing an von ihrem ersten Date mit Freddy zu erzählen. Ein romantisches Essen, dann schliefen sie miteinander. Ich freute mich für sie.
„Ach, ich plappere die ganze Zeit von mir. Wie ist es denn bei dir an der Liebesfront?“
Ich hasste dieses Wort und ich hasste diese Frage. Mein letztes Date hatte ich wahrscheinlich nach dem Abschluss, dem Schulabschluss. Ich war jetzt im fünften Semester. Seitdem habe ich mich verschlossen. Zunächst weil ich den Liebeskummer nicht besiegen konnte und dann, weil ich vor allem geflüchtet bin. Ich beobachtete, ich lebte nicht, ich spürte nicht – nicht, weil ich es so beschlossen hatte, sondern weil es so passierte, weil ich so war, weil ich nicht anders konnte. Ich konnte nicht loslassen, ich konnte mein Fenster nicht loslassen.
„Alles beim Alten.“, sagte ich. Sie seufzte. „Ich würde dir gerne helfen.“, fügte sie noch hinzu. „Du brauchst mir nicht zu helfen.“, sagte ich lachend. Brauchte ich wirklich keine Hilfe? Nur ich kann mir helfen. Alles wird gut.
Wir halfen Freddy und Marlene einige Monate später beim Umzug. Um elf Uhr abends saßen wir auf dem Boden und aßen Pizza. Es war gerade erst dunkel geworden. Wir stießen mit Bier auf ihre gemeinsame Wohnung an. Tobi sagte etwas, etwas was so nicht stimmte, das wusste ich, weil ich dazu etwas gelesen hatte. Paul war schon dabei ihn zu verbessern, aber ihm fiel ein Wort nicht ein, was ich wusste. Ich wollte was sagen, hatte aber, dann als ich ansetzte keine Kraft. So als würden meine Muskeln plötzlich erschlaffen. Ich lehnte mich hinten an die Wand und trank meine Cola. Bier mochte ich nicht.
„Wolltest du nicht etwas sagen?“, fragte mich Marlene.
„Hat sich schon erledigt.“, ich hob beruhigend die Hand.
„Ach komm, sag doch!“, Tobi hakte nach.
„Ich wollte das gleiche wie Paul sagen und das Wort was ihr sucht ist Fermentierung.“
„Oh verzeih Frau Doktor.“
Ich wünschte, ich hätte nichts gesagt. Es ist nichts weiter passiert. Ein harmloser Spruch. Niemandem wurde wehgetan. Das verstehe ich auch. Aber nicht mehr bloß Beobachter zu sein, sondern Teilnehmer, ist anstrengend und alles was an Reaktionen kommt, wirft mich aus der Bahn. Ich lehne mich wieder, an die Wand und fing an zu träumen, um mich zu beruhigen. Ich schaute aus meinem imaginären Fenster. Freddy holte Whisky. Er wollte richtig auf die Wohnung anstoßen. Ich ging nach Hause. Niemand hatte Einwände. Manchmal bin ich eine Spaßbremse. Eine ernste, melancholische, verklemmte idiotische Spaßbremse. Es war eine heiße Julinacht. Ich ging den zwanzigminütigen Weg zu Fuß. Busse fuhren um diese Zeit nicht mehr. Die anderen übernachteten auf dem Boden in Freddys und Marlenes erster gemeinsamer Wohnung. Ja manchmal schloss ich mich selbst aus. Ich nahm mich selber aus der Situation raus, weil es mir zu anstrengend war beteiligt zu sein. Manchmal wollte ich auch einfach kein Teil der Gruppe sein. Manchmal wurde ich etwas überheblich und dachte ich wäre etwas Besseres und war überzeugt zu wenig Aufmerksamkeit zu bekommen und deswegen sagte ich nichts, sondern entfernte mich – klingt logisch, nicht wahr?
Nächstes Wochenende luden uns Elisabeth und Paul zum Grillen auf ihrer Terrasse ein. Letztes Jahr bauten sie ein Haus. Es war stickig draußen. Es gab Schaschlik vom Fleisch und Schaschlik mit Gemüse, diverse Salate und Alufolienkartoffeln. Marlene brachte selbstgemachten Punsch mit. Tobi war besoffen und spielte im Garten Fußball gegen sich selbst. Paul und Freddy hörten Fußball im Radio. Marlene fragte Elizabeth gerade nach einem Rezept. Ich trank Rotwein. Einundzwanzig Uhr. Plötzlicher Platzregen. Alle schrien und sammelten sich eng an der Tür unterm Dach. Ich lachte in vollen Zügen los, exte mein Glas und lief in den Garten. Hob die Arme und den Kopf und drehte mich im Kreis.
„Bist du verrückt geworden?“, schrie Paul.
„Gleich trifft dich noch ein Blitz!“, Elli fluchte.
„Kommt! Kommt her! Es ist wunderbar!“, sagte ich.
„Nee lass mal.“, antwortete Freddy.
Das war meine andere Seite. Wenn irgendein Schalter umgelegt wurde, konnte ich albern, ja sogar bescheuert sein. Dafür mochten mich meine Freunde – für diese bescheuerte Seite, aber heute hatten sie keine Lust mit mir im Regen zu tanzen. Schließlich lachten sie mit mir. Das Fußballspiel war zu Ende und sie machten endlich Musik an. Are You Ready To Fly – Dune. Elisabeth scheuchte alle dazu auf das Essen reinzubringen. Es war schon längst hinüber. Durchnässt. So wie ich – wie mein schwarzes Wickelkleid mit weißen Punkten. Meine Vans waren voller Matsch. Die Haare hingen wie Schnüre links und rechts an meinem Gesicht herunter. Verschmierte Wimperntusche lief über meine Wangen. Ich war glücklich, gleichzeitig fühlte ich mich blöd. Der Regen hörte auf. Ich tanze zu Dune und schenkte mir selbst ein Glas Wein ein. Tobi bot mir eine Zigarette an, er wusste, wenn ich so drauf war, rauchte ich gerne. Er rauchte mit mir. Wir tanzten. Chemistry – Dune. Ich hüpfte und drehte mich bis mir schwindelig wurde. Bis ich mich setzten musste, die anderen saßen schon längst. Ich bekam Schluckauf. Hardcore Vibes – Dune. Ich schloss die Augen und wippte zur Musik. Die anderen diskutierten wieder über etwas. Es war mittlerweile stockfinster. Nur ein paar kleine Lichter und Kerzen leuchteten im Garten. Meine Augen waren nach wie vor geschlossen. Ich war am Einschlafen. Elli deckte mich zu. Mir gings gut. Alles wird gut.
„Sie hat sich heute echt weggeballert.“, Tobi lachte.
„Lass sie doch!“, Marlene legte die Decke über meine linke Schulter.
„Ich sag ja nichts. Ich gönne es ihr.“, Tobi rülpste.
„Ja in letzter Zeit war sie nicht gut drauf.“, sagte Paul.
Ich tat so, als würde ich aus einem tiefen Schlaf erwachen.
„Oh, Prinzessin! Ausgeschlafen?“ Freddy stach mich in die Seite.
„Gibt es noch O-Saft?“, ich gähnte. Alle lachten.
„Geht es dir gut?“, Marlene erkundigte sich. Sie hatte nur Angst davor, dass ich kotzen könnte, wäre nicht das erste Mal, aber ich fühlte mich gut.
„Ich fühl mich gut.“
Sie flüsterte okay. Schlagartig war ich genervt. Ich trank meinen O-Saft langsam und langweilte mich eine Weile.
„Leute, ich bin total müde. Ich denke, ich gehe. War schön heute mit euch.“, ich suchte meine Sachen zusammen und stand auf. La Passion – Gigi D’Agostino. Alle verabschiedeten sich herzlich, als wären sie traurig, dass ich schon (um kurz nach zwei) ging. Paul und Elli wohnten nur drei Straßen weiter. Die kühle, frische Luft strömte in meine Lungen. Ich lief, als wäre ich leicht wie eine Feder.
Im August schrieb ich meine Hausarbeiten und gab ausnahmsweise schon etwas früher ab, weil ich diesen Monat wirklich nichts anderes gemacht habe, außer zu schreiben, es war zu heiß zum Rausgehen und die anderen waren alle im Urlaub. Einmal war ich mit Anja an der Talsperre und verbrannte mir den Rücken. Aber sonst war da nichts. Es war in Ordnung. Ich fand mein Thema für die Hausarbeit interessant. Anfang September gab ich ab und hatte bis Oktober Zeit – erst da fing das Wintersemester an. Ich studierte Kunstgeschichte. Ich wollte unbedingt im Museum arbeiten, in einer hohen Position. Das war mein Traum. Für mich war das Museum das beste Medium für Bildung – Bildung ganz allgemein. Zuerst studierte ich jedoch Jura, auf den Rat meiner Eltern, die mich gerne als Anwältin gesehen hätten, aber dafür war ich nicht skrupellos genug, nicht ehrgeizig genug. Dennoch finanzierten sie mich komplett – auch wenn Kunstgeschichte für sie albern war.
Manchmal wenn ich komplett allein war, wirklich ganz, ganz allein war und alles – alles still war, vermisste ich das Gefühl jemanden zu vermissen. Ich wollte dieses kleine stechende Gefühl in meiner Brust fühlen, dass ich verliebt war, dass ich jemanden brauchte, dass ich jemanden aus tiefstem Herzen vermisste. Das wünschte ich mir manchmal, wenn ich in meinem Bett lag, an die Decke starte und kleine geschmacklose Tränen mir die Schläfen herunter flossen bis sie in meinen Haaren landeten. Dieses Gefühl fehlte mir. Eine Person vermissen – das ist eines der stärksten Gefühle, wenn man allein ist. Du bist allein und du sehnst dir nichts anderes, als diese eine Person herbei und dieser Schmerz dieser kleine Schmerz, den du spürst in deiner Brust, in deinem Herzen, er tut weh, aber du weißt irgendwann wirst du diese Person nicht mehr vermissen, weil sie dann bei dir sein wird und der Schmerz, du wirst dich nicht mal an ihn erinnern, er wird einfach weg sein. Ja das vermisste ich, dieses kleine schmerzende Gefühl. Ich schloss die Augen und zwei letzte kleine geschmacklose Tränen liefen mein Gesicht herunter. Ich drehte mich auf dem Bauch und schlief ein. Alles wird gut.
Früher war Hoffnung für mich albern, nichts was es sich zu haben lohnt. Hoffnung braucht man nicht, dachte ich. Ich dachte, es würde ohne gehen. Ich dachte, ich wäre schlauer als alle anderen, weil ich den Code geknackt habe – wenn ich keine Hoffnung habe, bin ich glücklicher. Alles wird gut – auch ohne Hoffnung. Hoffnung ist was für Schwächlinge, dachte ich. Und deswegen verschloss ich irgendwann alle Türen, alle Fenster und verließ meine Wohnung nicht mehr. Ein paar Mal fragten mich die anderen, ob ich mitkommen würde, was essen, zum Weihnachtsmarkt, ein Film bei Elli und Paul gucken, ein paar Mal fragten sie mich. Jedes Mal sagte ich nein. Und dann fragten sie nicht mehr. Und ich war zufrieden. Zufrieden, dass ich mich jetzt gänzlich in meinem Selbstmitleid wälzen konnte. Jetzt war ich allein. Niemand wollte mich. Ich fühlte mich wie eine Heldin. Ich brauche euch nicht! Ich schaffe es allein. Ihr könnt mir eh nicht helfen! Durch mein Selbstmitleid fühlte ich mich, als wäre ich so viel mehr Wert. Ich war einsam und stolz drauf. Es schmerzte zwar, aber ich fühlte mich stark.
Bis ich mich nicht mehr stark fühlte. Ich fühlte mich schwach und Einsamkeit war nichts gutes mehr. Ich weinte wieder. Ich konnte endlich wieder weinen. Ich fühlte mich elend. Verlassen. Verraten. Wo sind bloß alle? Wo seid ihr? Warum seid ihr nicht hier? Ich brauche doch bloß ein liebes Wort. Bitte. Wo seid ihr? Ich fühlte mich so dreckig. Schmutzig. Schmutzig vom Selbstmitleid. Ich ekelte mich. Ich wollte die Augenringe nicht mehr im Spiegel sehen. Ich schluchzte so laut, dass ich heiser wurde. Es tat so weh. Es tat so weh, allein zu sein. Alles wird gut.
Alles wird gut – redete ich mich mir ein. Alles wird gut. Alles wird gut. Wirklich, es wird alles wieder gut. Ich konnte schmunzeln, über meinen naiven Optimismus.
Schon wieder wurde es Frühling und ich traute mich spazieren zu gehen. In meiner Wohnung stank es nach Schweiß und Schlaf. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Frühlingskrokusse und Schneeglöckchen. Frisch gewaschene Autos kamen aus den Waschanlagen. Grillgeruch. Ich atmete tief ein. Und überlegte, ob Hoffnung vielleicht nicht albern ist, dass Hoffnung nichts für Schwächlinge ist. Hoffnung ist etwas für die, die sich entscheiden stark zu sein. Stärker als ich. Stärker als der Schmerz. Hoffnung gibt dir Kraft, überlegte ich. Die Leute, die vorbei gingen, lächelten mich an und ich bekam Hoffnung. Hoffnung, dass alles gut wird. Vielleicht würde ich noch eine Weile allein bleiben – doch ich hatte Hoffnung, auch wenn ich mir trotzdem albern und viel zu erwachsen vorkam. Alles wird gut.